Graphic Novel trifft Gedenkarbeit: Workshops zur Sichtbarmachung von Biografien von NS-Zwangsarbeitenden in Berlin-Lichtenberg
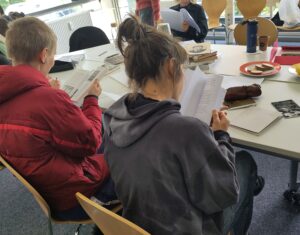
Anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai 2025 fand in der Anton-Saefkow-Bibliothek ein Workshop statt, der in dieser Form neuartig war. Der Workshop richtete sich an Menschen unterschiedlichen Alters mit verschiedenen Vorerfahrungen im Gestalten. Dadurch entstand eine Gruppe von Teilnehmenden, deren Mitglieder ganz unterschiedliche Vorkenntnisse und Zugänge zum Thema NS-Zwangsarbeit und dessen Darstellung mitbrachten. Diese Mischung ermöglichte einen lebendigen Austausch, der einen persönlichen, aber auch kreativen Weg schaffte, sich mit diesem bedrückenden Teil der deutschen Geschichte auseinandersetzten. Der Workshop wurde so zu einem besonderen Beitrag zur Erinnerungskultur, der Geschichte greifbar macht und neue Wege des Gedenkens eröffnet.
Die Historikerin Ellen Fischer konzipierte den Workshop und führte diesen in Kooperation mit dem Förderkreis der Lichtenberger Bibliotheken e.V., Mitarbeitenden der Stadtbibliothek Lichtenberg, der Fach- und Netzwerkstelle Licht-Blicke, dem Antisemitismusbeauftragten des Bezirks Lichtenberg André Wartmann und dem Comic Künstler Mikael Ross durch. Es entstand ein Erinnerungsprojekt, das Geschichte und Gegenwart auf eindrucksvolle Weise miteinander verbindet.
Ziel des mehrteiligen Workshops war es, dass sich die Teilnehmenden kreativ und vertiefend mit dem Thema Zwangsarbeit während des Nationalsozialismus auseinandersetzen – am Beispiel konkreter Orte und Biografien im Bezirk Lichtenberg. Im Mittelpunkt stand dabei die künstlerische Umsetzung historischer Einzelschicksale in Form von Graphic Novel-Szenen. Der Zugang über das Zeichnen und Erzählen förderte nicht nur ein intensives historisches Verständnis, sondern eröffnete auch Raum für persönliche Reflexion und Mitgefühl.
Zwangsarbeit im Nationalsozialismus – ein verdrängter Teil lokaler Geschichte
13 Millionen Menschen mussten während des Nationalsozialismus Zwangsarbeit in Deutschland leisten – in Lagern, Rüstungsbetrieben, auf Baustellen, in Haushalten oder landwirtschaftlichen Betrieben. Auch im heutigen Bezirk Berlin-Lichtenberg gab es zahlreiche Einsatzorte und Lager, die bis heute kaum bekannt und erinnerungskulturell nur vereinzelt sichtbar sind.
Durch vier ausgewählte Biografien sollten diese historischen Zusammenhänge greifbarer und die Lebens- und Zwangsarbeitsbedingungen der Menschen veranschaulicht werden. Jede dieser Geschichten erzählt von einem anderen Hintergrund, von anderen Erfahrungen – und doch teilen sie alle die Erfahrung von Entrechtung, Ausbeutung und Gewalt.
Die Geschichte von Gertrud Kolmar, einer jüdischen Dichterin aus Berlin, macht deutlich, wie jüdische Menschen im Zuge der NS-Verfolgung aus allen Lebensbereichen verdrängt und der Verfolgung und Ermordung während des Holocausts ausgesetzt waren. Gertrud Kolmar verlor nicht nur ihr Haus und ihre Unabhängigkeit, sondern wurde zudem zur Zwangsarbeit in einer Lichtenberger Papierfabrik verpflichtet. Nach der sogenannten „Fabrikaktion“, bei der die bis 1943 noch in Berlin verbliebenen Juden und Jüdinnen ebenfalls verhaftet und deportiert wurden, verschleppten die Nationalsozialisten auch Gertrud Kolmar nach Auschwitz, wo sie kurz nach ihrer Ankunft ermordet wurde. Gertrud Kolmar hinterließ ein beeindruckendes Gesamtwerk an Gedichten aufgrund dessen sie in der Gegenwart als eine der bedeutendsten deutschen Lyrikerinnen gilt.
Lidia A., eine junge Frau aus der heutigen Ukraine, wurde im Rahmen einer Razzia verschleppt und zur sogenannten „Ostarbeiterin“ erklärt – ein Ausdruck, der heute für die schlechtere Behandlung von osteuropäischen Zwangsarbeitenden steht. In einem Zwangsarbeitendenlager an der Landsberger Allee war sie katastrophalen Bedingungen ausgesetzt. Die deutsche Bevölkerung sah, wie diese Menschen in die Lager untergebracht wurden, um in Fabriken rüstungswichtige Materialien für Deutschland herzustellen. Nur wenige halfen. Die Erinnerungen von Lidia A., die diese Zeit überleben konnte, erinnert an die millionenfache Verschleppung junger Menschen aus Osteuropa, um für den nationalsozialistischen Staat Zwangsarbeit leisten zu müssen.
Theodor Wonja Michael wuchs als Kind eines aus Kamerun eingewanderten Vaters in Deutschland auf. Schon als Kleinkind musste er in den sogenannten Völkerschauen auftreten – rassistische Zurschaustellungen, die Teil des kolonialen Blicks auf Schwarze Menschen in Deutschland waren. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde es für Theodor W. Michael unmöglich ein normales Leben führen zu können. Aufgrund der Nürnberger Rassengesetze wurde ihm eine Ausbildung verwehrt. Ab 1943 wurde er zur Zwangsarbeit in einer Munitionsfabrik in Lichtenberg verpflichtet. Seine Biografie zeigt die Kontinuität und Verknüpfungen von Kolonialismus, Rassismus und NS-Verfolgung als Teil der nationalsozialistischen Ideologie. Nach einer beeindruckenden Karriere als Schauspieler, Journalist und Staatsbeamter setzte er sich bis zu seinem Tod als engagierter Zeitzeuge ein und teilte seine Erinnerungen mit vielen Schulklassen in ganz Deutschland.
Wilhelm v. R. D., ein niederländischer Student, wurde zur Zwangsarbeit beim Unternehmen Knorr-Bremse verpflichtet. Den Luftangriffen auf Berlin war er schutzlos ausgeliefert – wie viele Zwangsarbeitende wurde ihm der Zugang zu Luftschutzkellern verwehrt. Seine Berichte verdeutlichen die permanente Bedrohung, denen Zwangsarbeitende in der deutschen Kriegswirtschaft ausgesetzt waren.
Vom historischen Lernen zur künstlerischen Gestaltung
Die Herangehensweise des Workshops wurde bewusst prozessorientiert gestaltet: Nicht das perfekte Endprodukt stand im Vordergrund, sondern der Weg des Verstehens, des Nachfragens, des künstlerischen und persönlichen Suchens. Die Workshopleitenden begleiteten die Gruppen auch nach dem Auftaktmodul weiter – in Einzelgesprächen, digitalem Feedback und zwei weiteren Präsenzterminen. So entstand über mehrere Wochen hinweg eine Vielzahl von zeichnerischen und erzählerischen Umsetzungen. Die Teilnehmenden entwickelten eigene Perspektiven auf das historische Material, setzten sich mit den Grenzen ihrer Darstellungsmöglichkeiten auseinander und brachten ihre persönlichen Fragen und Gedanken in die Arbeit ein. Der Workshop verband geschichtliches Lernen mit kreativer Praxis. Nach einem gemeinsamen Einstieg in das Thema Zwangsarbeit und die Beschäftigung mit den historischen Quellen wählten die Teilnehmenden jeweils eine der vier Biografien aus, mit der sie sich vertiefend auseinandersetzen wollten. In angeleiteten Übungen erlernten sie Grundlagen des Erzählens in der Form der Graphic Novel: So widmeten sie sich den Fragestellungen: Welche Darstellung des Themengebietes gibt es bereits? Welche Aspekte der Biografie will ich darstellen? Wie kann historische Erfahrung bildlich dargestellt werden, ohne Klischees zu reproduzieren?
Erinnerung sichtbar machen – Ausstellung und öffentliche Plakate
Die im Workshop entstandenen Graphic Novel-Szenen werden derzeit grafisch aufbereitet und nachbearbeitet. Im Herbst 2025 sollen sie im Rahmen einer Ausstellung in der Anton-Saefkow-Bibliothek in Lichtenberg erstmals öffentlich präsentiert werden. Als mobile Ausstellung konzipiert, kann sie zudem an weiteren Orten gezeigt werden. Ein besonderes Element des Projekts ist die Übertragung einiger Arbeiten in großformatige Plakate, die an relevanten Orten in Berlin-Lichtenberg installiert werden. Diese Interventionen im öffentlichen Raum ermöglichen es Passant:innen, spontan mit Geschichte in Berührung zu kommen, innezuhalten und einen Bezug zur eigenen Umgebung herzustellen.
Ein Beitrag zur lebendigen Erinnerungskultur
Der Workshop leistet einen konkreten Beitrag zur Stärkung der Erinnerungskultur im Stadtteil Lichtenberg und darüber hinaus. Er macht die Geschichte der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus nicht nur sichtbar, sondern vermittelt sie über einen emotional und gestalterisch zugänglichen Zugang. Durch die Verbindung von historischen Quellen, individueller Auseinandersetzung und künstlerischer Praxis gelingt es, junge und ältere Menschen gleichermaßen zu erreichen. Gleichzeitig stärkt das Projekt die Fähigkeit zur Empathie und das Verständnis für historische Verantwortung – beides wichtige Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft. In Zeiten, in denen antisemitische, rassistische und geschichtsrevisionistische Tendenzen zunehmen, setzt der Workshop ein deutliches Zeichen für eine erinnerungspolitisch wache und solidarische Stadtteilgesellschaft sowie darüber hinaus.
Die Workshopreihe wurde vom Runden Tisch für Politische Bildung Lichtenberg gefördert.
