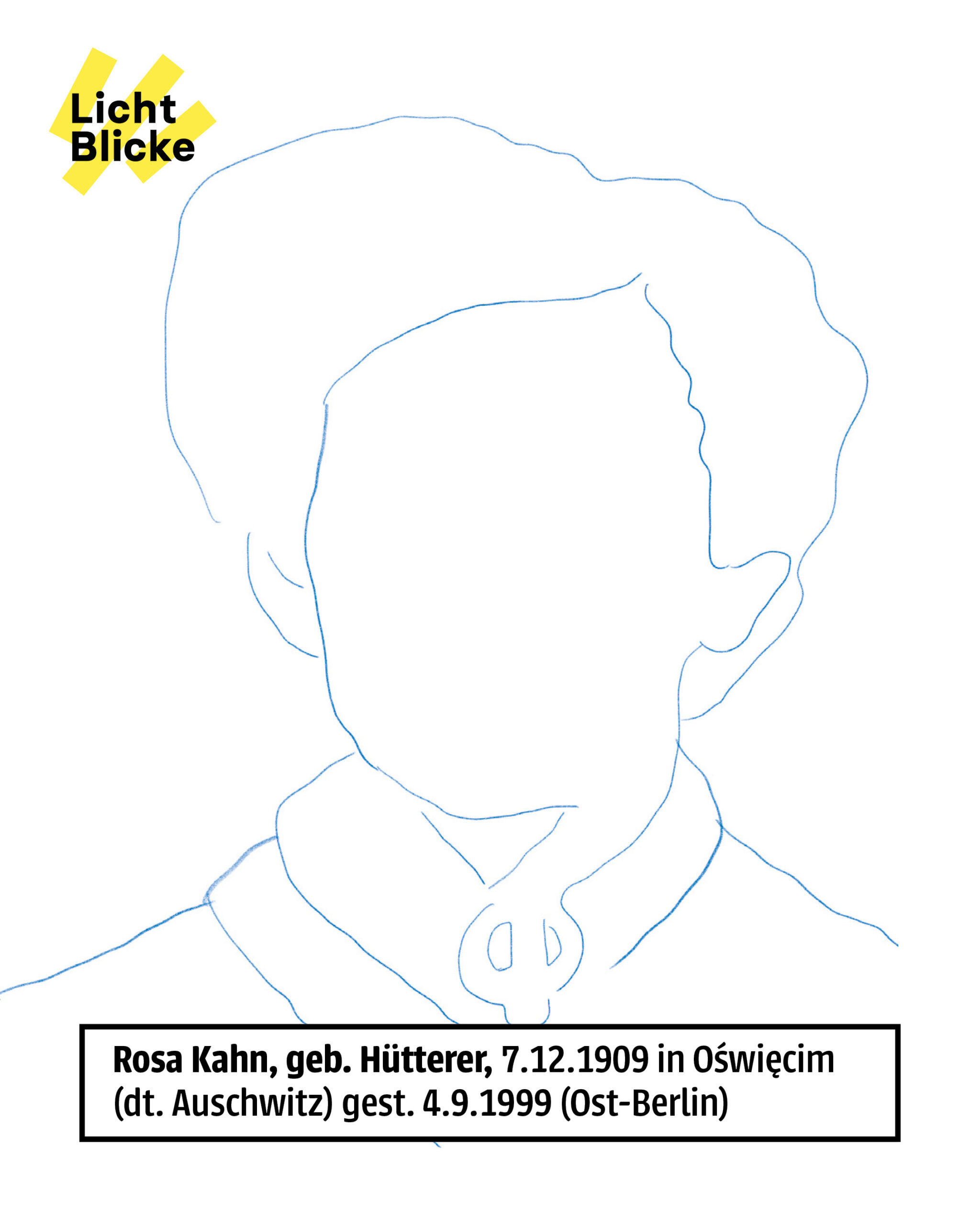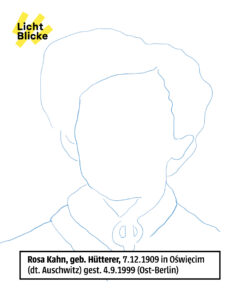
Von Rosa Kahn ist bisher nur ein Foto zu finden, auf dem man ihre Gesichtszüge nur erahnen kann.
Lebte bis 1933 im Archibaldweg (früher Ostbahnstraße) und leitete bis 1933 eine kommunistische Jugendgruppe. Vor der Verfolgung der Nazis floh sie Ende der 1930er ins Exil. Ihr Grab befindet sich im Pergolenweg auf dem Friedhof Friedrichsfelde.
„Seit Ende des Krieges ging es mir gesundheitlich nicht sehr gut, und als wir in Berlin waren, hatte ich ein sehr niedriges Gewicht. Meine Lunge war gefährdet, und ich durfte nicht arbeiten. Die Gewissheit, dass meine Eltern und Geschwister durch die Nazis umgekommen waren, war wohl die seelische Ursache meines Zustandes.“ [1]
Rosa Hütterer wuchs mit ihren fünf Geschwistern in einer bürgerlichen, streng orthodoxen jüdischen Familie zunächst in Polen und später Berlin auf.Ihr Vater war Weinhändler und Fabrikbesitzer, ihre Mutter führte die Wirtschaft und machte Gelegenheitsarbeiten in Heimarbeit, um das Einkommen der Familie zu ergänzen. Nach dem Ersten Weltkrieg zog die Familie nach Berlin. Nach der Volksschule besuchte Rosa Kahn eine jüdische Mittelschule in Berlin und absolvierte anschließend eine Ausbildung zur Schriftsetzerin. Mit ihrer Schwester fand Hütterer zum „Schwarzen Haufen“, einer Wandervogelgruppe, die Ausflüge unternahm. Hier kam Hütterer das erste Mal mit einer politischen Organisation in Berührung. Nach der Auflösung dieser Gruppe 1928 trat sie in den kommunistischen Jugendverband (KJVD) ein, 1930 in die KPD und den Arbeitersportverein Fichte sowie die Internationale Arbeiterhilfe (IAH) und Roten Hilfe Deutschland (RHD). Im KJVD war sie als Funktionärin aktiv und leitete bis 1933 eine Gruppe in Lichtenberg. Aufgrund der unsicheren politischen Situation zu Beginn der 1930er Jahre, die für sie als nicht-deutsche Staatsbürgerin noch bedrohlicher war, heiratete sie 1932 ihren Freund, den jüdischen Kommunisten Siegbert Kahn. Ab 1933 leistete Rosa Kahn mit ihrem Mann Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Sie war als Kurierin aktiv und an der Vervielfältigung illegaler Literatur beteiligt. Weil sie in ihrem Kiez im Archibaldweg zu bekannt waren und es schon erste Hausdurchsuchungen gab, zog Kahn mit ihrem Mann im Frühjahr 1933 in die Landsbergerstr. Bereits Anfang November 1933 erstmals verhaftet, wurde sie bis Ende März 1934 im Polizeipräsidium am Alexanderplatz, im Frauengefängnis Barnimstraße und im Konzentrationslager Moringen in „Schutzhaft“ genommen. Bei der Verhaftung war sie schwanger, wegen bevorstehender Entbindung ihres Sohnes Gerhard wurde sie Ende März 1934 entlassen. Nach ihrer Entlassung engagierte sie sich erneut in einem Freundeskreis um Hans und Carmen Fruck in Weißensee und unterstützte Angehörige politisch Inhaftierter durch das Sammeln von Geld und Lebensmitteln.
Wegen der anhaltenden Ausgrenzung und der Drohung vor erneuter Verhaftung emigrierte Kahn mit ihrem Sohn im Juli 1938 zunächst nach Prag, wo bereits ihr Mann wartete. Nach der Besetzung von Teilen Tschechiens half Rosa Kahn anderen Genoss:innen zur Flucht. Ihren Sohn schickte sie auf einen Kindertransport nach Großbritannien. Im April 1939 folgte sie mit ihrem Mann. In London arbeitete sie in einer Fabrik, war Betriebsrätin, engagierte sich in der Freien Deutschen Bewegung und im Freien Deutschen Kulturbund.
Im August 1946 kehrten die Kahns nach Berlin zurück und lebten zunächst in Zehlendorf bei einer Freundin. Rosa Kahn arbeitete als Übersetzerin und anschließend als Redakteurin im Dietz-Verlag Berlin. 1949 zog die Familie von Zehlendorf nach Treptow, später lebten sie in Köpenick. Rosa Kahn starb am 4. September 1999 in Ost-Berlin und wurde neben ihrem Mann auf der Grabanlage Pergolenweg auf dem Friedhof Friedrichsfelde bestattet.
Quellen:
- BVVdN (Hrsg.): Widerstand in Berlin gegen das NS-Regime 1933 bis 1945. Ein biographisches Lexikon. Berlin 2017
- Bundesarchiv, Bestand IVVdN, Akte 490 (Rosa Kahn)
- Antrag auf Anerkennung als Opfer des Faschismus. Landesarchiv Berlin, Kahn, Rosa C Rep. 118-01, Nr. 1758
Glossar:
Arbeitersportverein Fichte (ASV): 1890 von Sozialdemokrat:innen als Antwort auf ihre Ausgrenzung aus bürgerlichen Sportvereinen in Berlin gegründeter Arbeitersportverein. Ab Anfang der 1920er Jahre kommunistisch dominiert, wurde der ASV mit rund 10.000 Sportler:innen zum weltweit größten „roten“ Sportverein. Er war eine der wenigen kommunistisch geprägten Organisationen, die sich explizit auf die Illegalität nach der Machtübertragung vorbereiteten, die Fichtesportler:innen zerstörten gezielt Mitgliederkarteien, Mobiliar und Sportgeräte sowie -plätze. Nachdem der ASV nach der Machtübertragung verboten war, organisierten sich viele Mitglieder illegal. Ein Teil bewahrte die Strukturen durch Gründung neuer, vermeintlich unpolitischer Sportvereine oder durch den Übertritt in bürgerliche Vereine als geschlossene Sparten.
Internationale Arbeiterhilfe (IAH): Die Internationale Arbeiterhilfe war eine 1921 in Berlin gegründete KPD-nahe Solidaritätsorganisation zur Unterstützung von Arbeiter:innen mit Sitz in Berlin. Die Gründung erfolgte als Reaktion auf einen Aufruf Wladimir Iljitsch Lenins nach internationaler Unterstützung wegen einer Dürre- und Hungerkatastrophe im Wolgagebiet 1921-1922. Die IAH half in den folgenden Jahren Arbeiter:innen bei Arbeitskämpfen, aber auch bei Kriegen und Naturkatastrophen durch die Verteilung von Lebensmitteln, Kleidung und Geld. Sie unterhielt Volksküchen und Kinderheime. Einnahmen erfolgten durch Spendenaufrufe und eigene Industriebetriebe in der Sowjetunion, aber auch durch Filmproduktionsgesellschaften und den Neuen Deutschen Verlag. Nach der Machtübertragung wurden Funktionär:innen verhaftet, die IAH musste ihre legale Tätigkeit in Deutschland einstellen.
Rote Hilfe (RHD): Die Rote Hilfe Deutschland wurde 1924 als KPD-nahe Solidaritätsorganisation für in Not geratene Arbeiter:innen gegründet. Nach der Machtübertragung und der Zerschlagung der Arbeiter:innenbewegung kam es auch zu Verhaftungen in den Reihen der RHD, die sich deswegen neu organisieren musste. An die Stelle der überwiegend männlichen Verhafteten rückten häufig Frauen, die Unterstützung von Inhaftierten und deren Angehörigen mit Geld- und Lebensmittelsammlungen organisierten.
[1] Bundesarchiv, Bestand IVVdN, Akte 490 (Rosa Kahn)
Dieser Beitrag ist Teil des Projekts Widerständige Frauen gegen den Nationalsozialismus in Lichtenberg des Runden Tisches für Politische Bildung Lichtenberg in Kooperation mit der Zeithistorikerin Trille Schünke-Bettinger (Antifaschistinnen aus Anstand & Netzwerk Frauentouren) und Fritzi Jarmatz (Visuelle Kommunikation & Ideenräume).
Text & Recherche: Trille Schünke-Bettinger
Grafik: Fritzi Jarmatz